Blog aktualisiert am
neuere Einträge ...
ESC: Ein Hoch auf das Semifinale
Ohnehin so gut wie sicher waren Dänemark, Russland und die Ukraine. Wenn es nach den Buchmachern geht, haben alle drei Länder gute Chancen auf einen Sieg im Finale. Völlig zu Recht raus aus dem Bewerb sind Serbien, Montenegro und Slowenien. Es gibt nun mal Dinge, die niemand ein zweites Mal hören möchte. Zypern war halt, so wie wohl auch Österreich, um eine Spur zu fad. Die einzigen, um die's mir wirklich leid tut, sind die Kroaten mit ihrem wunderbaren „Mižerja“. Das war ein Song, den ich gern nochmal gehört hätte im Finale und für den ich (gerade wegen seiner geringen Chancen) ununterbrochen angerufen habe. Freundlichkeitsanrufe gingen auch an die Niederlande (der Marco hat so gezittert drum) und an Irland (für Gerard, dessen Leben jährlich davon abhängt), obwohl keiner der beiden Songs mein kleines Seelchen wirklich berührt hat. Das Ergebnis zeigt: Es wäre offenbar gar nicht so dringend nötig gewesen. Das Gewissen beruhigts trotzdem. :)
Aber unterm Strich: 16 Songs waren es, nur in einem einzigen Fall (Kroatien) bin ich mit dem Abstimmungsergebnis nicht einverstanden. Das ist durchaus respaktabel. Gut gemacht, Europa.
(Vielleicht liegt meine relative Zufriedenheit im Moment ja auch nur daran, daß keiner meiner absoluten Lieblinge im heutigen Semifinale an der Reihe war. Mal sehen, wie die Stimmung kippt, wenn die gschissenen Schnulzenfans mir am Donnerstag meine Griechen rauswählen! *LOL*)
Gar nicht gut gemacht hats, wie könnte es anders sein, Andy Knoll. Man kann sich als Moderator ununterbrochen in den Vordergrund drängen und herablassend über die Teilnehmer ablästern … als letzte Rettung, wenn man sonst nichts auf dem Kasten hat. Mir wurde diese eitle Perversion auf ORF1 nach wenigen Minuten zu bunt. Einsfestival bot, wie gewohnt, mit Peter Urban eine um Welten bessere Alternative: Urban kommentiert knapp, zurückhaltend, trocken, respektvoll … und wenn er dann doch mal eine seiner klugen Bösartigkeiten losläßt, lacht man umso lauter.
7 Kommentare - Kommentar verfassen
Jolla: I Am The Other Half
 Es wird allgemein erwartet, daß Jolla sein erstes Smartphone mit dem Maemo/MeeGo-Nachfolger Sailfish nächste Woche vorstellt. (Zu kaufen wird es allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte sein.)
Es wird allgemein erwartet, daß Jolla sein erstes Smartphone mit dem Maemo/MeeGo-Nachfolger Sailfish nächste Woche vorstellt. (Zu kaufen wird es allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte sein.)
Zeitlich passend gab es einen Auftritt von Marc Dillon in dieser chinesisch/englischen Diskussionsrunde anläßlich der GMIC in Peking. Auch neu und gewollt geheimnisvoll: Ein neuer Werbeclip von Jolla mit dem Titel I Am The Other Half. Was die wohl mit „the other half“ meinen? Einfachster Erklärungsversuch so far: Die erste Hälfte war die Präsentation des Betriebssystems, jetzt kommt die zweite Hälfte, die Hardware. :)
Gspannt bin ich, Kinder! Gspannt! :)
10 Kommentare - Kommentar verfassen
„HTML“ 5: Mit DRM ins Web der Medienkonzerne
 Die ganze Sache mit „HTML“ 5 war mir nie geheuer. Schon seit 2008 verfolge ich mit großer Sorge die Entwicklung, die immer weiter weg führt von dem Erfolgsmodell World Wide Web, wie wir es kannten.
Die ganze Sache mit „HTML“ 5 war mir nie geheuer. Schon seit 2008 verfolge ich mit großer Sorge die Entwicklung, die immer weiter weg führt von dem Erfolgsmodell World Wide Web, wie wir es kannten.
Neuester Streich im Dunstkreis von „HTML“ 5 ist die in Arbeit befindliche Spezifikation Encrypted Media Extensions. Sie wird von Google, Microsoft und Co. getrieben und standardisiert einen Weg zum Einbinden von DRM („Digital Restrictions Management“ oder „digitale Rechteminderung“) direkt im Herzen des World Wide Web, in den vom World Wide Web Consortium (W3C) abgesegneten technischen Empfehlungen.
Die Auswirkungen wären beträchtlich. Natürlich gibt es zum einen die direkten Folgen, die jeder spüren wird. Derzeit ist das Web eine offene Plattform. Notwendige Zugangsbeschränkungen zum Beispiel zum eigenen GMX-Account lassen sich über Mechanismen wie Benutzername/Passwort realisieren. Das wars dann aber auch schon. Was ich einmal in meinem Browser angezeigt bekomme, kann ich
- so oft sehen, wie ich möchte,
- speichern,
- verschicken,
- von anderen Programmen als dem Browser verarbeiten lassen
und so weiter. Wenn ein sogenannter „Rechteinhaber“ das verhindern will, muß er sich auf eine andere Infrastruktur verlassen und zum Beispiel auf kommerzielle Browser-Plugins ausweichen. Das ist mit Aufwand verbunden und daher eher die Ausnahme.
Wenn ein DRM-Mechanismus im Web standardisiert wird, liegt die Latte niedriger. Es wird einfacher sein, Inhalte zu beschränken - und es wird daher häufiger vorkommen. Ein Video darf nur 1x angesehen werden, fürs zweite Mal muß man erneut zahlen. Ein Katzenfoto darf man ansehen, aber nicht an Freunde verschicken. Den wissenschaftlichen Artikel kann man online lesen, aber nicht abspeichern. Musik darf man streamen, aber nicht aufs Handy überspielen. Alles, was bisher nur aus den Walled Gardens von Apple & Co. bekannt war, wird dann Teil des heute noch freien World Wide Web.
Es gibt aber noch ein zweites, tieferliegendes Problem: Wenn DRM-Mechanismen so leicht von einer Webseite angefordert werden können, dann müssen sie auch halbwegs verläßlich in den Browsern implementiert werden. Ein Browser, der die Funktion nicht bereitstellt, würde vom einfachen Benutzer nicht als moralisch überlegen, sondern als nicht funktionstüchtig wahrgenommen. (Ähnlich wie Handy-Browser ohne Flash-Unterstützung.) Bleibt die Frage: Wie lösen quelloffene, freie Browser das Problem? Eine Implementierung im offenen Teil des Codes ist problematisch, sie könnte ausgehebelt und von den Anbietern als nicht ausreichend sicher eingestuft werden. Bleibt eine Implementierung als proprietäres Plugin, ähnlich wie Flash … mit all ihren Nachteilen: Ein proprietäres Plugin wird nicht auf allen Betriebssystemen und nicht für alle Versionen zur Verfügung stehen, darf aus rechtlichen Gründen nicht einfach so weitergegeben werden, kann bei technischen Problemen nicht schnell repariert werden usw. usw.
Bürgerrechtsbewegungen wie die EFF oder Defective By Design kämpfen einen ersten Kampf, in dem es darum geht, öffentliches Bewußtsein für dieses Problem zu schaffen. In einer von mir unterzeichneten Petition forderten sie das W3C auf, die Arbeit an diesem Projekt einzustellen. Natürlich lassen sich Microsoft und Google nicht von ein paar tausend Unterstützungserklärungen abhalten. Aber darum gings aus meiner Sicht auch nicht. Es geht jetzt zunächst darum, das Thema überhaupt bekannt zu machen und es zu ermöglichen, daß Internet-User sich eine Meinung bilden.
ESC: Wettquoten - Baku 2014?
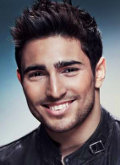 Die ersten Proben in Malmö sind vorbei. Wie haben sich die Eindrücke von der Bühne auf die Wettquoten niedergeschlagen? Im Vergleich zum letzten Mal hat sich einiges bewegt. Den größten Nachrichtenwert hat wahrscheinlich aber der einzige Song, bei dems keine Veränderung gab: Dänemark sitzt mit seinem gefälligen, ein bißchen langweiligen „Only Teardrops“ seit Monaten auf Platz 1 fest und rührt sich nicht von der Stelle:
Die ersten Proben in Malmö sind vorbei. Wie haben sich die Eindrücke von der Bühne auf die Wettquoten niedergeschlagen? Im Vergleich zum letzten Mal hat sich einiges bewegt. Den größten Nachrichtenwert hat wahrscheinlich aber der einzige Song, bei dems keine Veränderung gab: Dänemark sitzt mit seinem gefälligen, ein bißchen langweiligen „Only Teardrops“ seit Monaten auf Platz 1 fest und rührt sich nicht von der Stelle: | Rang | Land | Song | ⇅ |
| Interpret | |||
| 1 | Dänemark | Only Teardrops | ↔ |
| Emmelie de Forest | |||
| 2 | Ukraine | Gravity | ↗ |
| Zlata Ognevich | |||
| 3 | Norwegen | I Feed You My Love | ↘ |
| Margaret Berger | |||
| 4 | Russland | What If | ↗ |
| Dina | |||
| 5 | Italien | L'Essenziale | ↗ |
| Marco Mengoni | |||
| 6 | Aserbaidschan | Hold Me | ↑ |
| Farid Mammadov | |||
| 7 | Georgien | Waterfall | ↗ |
| Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani | |||
| 8 | Deutschland | Glorious | ↗ |
| Cascada | |||
| 9 | Niederlande | Birds | ↘ |
| Anouk | |||
| 10 | Schweden | You | ↘ |
| Robin Stjernberg |
Raus ist Bonnie Tyler für „The United Kingdom“. Sie ist auf den 14. Platz abgerutscht.
Dafür gibts einen interessanten Neueinsteiger: Aserbaidschan. Das Land ist seit gestern gleich auf Platz 6 geklettert, nachdem Ausschnitte der ersten Probe im Web zu sehen waren. Der Schmachtfetzen von Farid Mammadov ist eines der drei Lieder, die sowohl bei den Wettquoten als auch in meiner persönlichen Bestenliste in den Top 10 liegen. Der herzige kleine Farid wird beim ESC-Publikum seine Fans finden. Die Bühnenshow enthält Elemente, die nicht ganz unoriginell sind. Vor allem aber: Genau wie 2011, als Aserbaidschan zum letzten Mal gewann, ist auch heuer die Türkei nicht im Finale vertreten. 2011 hatten einige ESC-Journalisten im Vorfeld der Show gemeint: Allein die Tatsache, daß nur die „kleine Türkei“ zur Auswahl steht, vervielfacht deren Chancen bei der votingfreudigen türkischen Diaspora in Europa. Diese Journalisten hatten damals Recht. Obs 2013 auch so kommt? Farid Mammadov hat seinen Song sicherheitshalber schon mal in einer „Türkçe versiyon“ veröffentlicht. Guckst Du hier: Bana Dönsen.
Ach ja, noch eine Kleinigkeit: Dem österreichischen Gsangl haben die Probentage nicht gut getan. Bei den Wettquoten fürs erste Semifinale fand sich Natália Kelly bisher immer konstant und sicher in den oberen 10 Plätzen, denen ein Finaleinzug vergönnt ist. Nun ist sie abgestürzt und klammert sich gerade noch auf Platz 10 fest - Tendenz fallend.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
ESC: Voting Sheets fürs Semifinale
Zur Vorbereitung gehören die Voting-Sheets, die seit vielen Jahren die Grundlage des ESC-Vergnügens bilden. Für die zwei Semifinalshows hab ich sie jetzt mal online gestellt:
Voting Sheet zum ersten Semifinale
Voting Sheet zum zweiten Semifinale
Wie üblich die Bitte: Falls jemand noch Fehler entdeckt, möge er sie mir mitteilen. Sonst landen sie womöglich unkorrigiert im Voting Sheet für das Finale am 18.5.!
5 Kommentare - Kommentar verfassen
Erstes Grillen
 Es wurde kurzfristig umdisponiert: Statt des Indoor-Abendessens, das die Gastgeber als Ersatz fürs wettertechnisch nicht opportune Grillen vorgesehen hatten, gabs dann doch einen Grillabend mit allem Drum und Dran. Manches vom Drum und Dran war sogar doppelt oder in alternativer Ausführung vorhanden. Yummie!
Es wurde kurzfristig umdisponiert: Statt des Indoor-Abendessens, das die Gastgeber als Ersatz fürs wettertechnisch nicht opportune Grillen vorgesehen hatten, gabs dann doch einen Grillabend mit allem Drum und Dran. Manches vom Drum und Dran war sogar doppelt oder in alternativer Ausführung vorhanden. Yummie!
Verschiedene Vorspeisen, saftiges Steak, gschmackiges Gemüse, bratige Würschtl, der mittlerweile traditionelle Kartoffelsalat, Nachspeis 1, Nachspeis 2, mundgelutschte Schokolinsen … und natürlich das Alsterwasser, das zum Grillen einfach dazughört für echte Kerle. :)
Apropos doppeltes Drum und Dran: Die Mäuse! Die Mäuse! Unglaublich, wie schmeichellieb die immer wieder sind. Der treue, liebevolle Blick eines Hundes, während man grad eine Bratwurst ißt - der wird nur mehr übertroffen von den treuen, liebevollen Blicken zweier Hunde, während man eine Bratwurst ißt. :)
Ein gelungener Start in die Saison. Der Taxler hat anschließend aufgrund unserer Manöverkritik beim Heimfahren neugierig nachgefragt, welches Lokal das denn ist da draußen. Tja. Chez Wolfi et Raini. Merci! :)
Ort anzeigen auf: Google Maps,
Mapquest
Suche nach Websites und
Fotos in der Nähe
12 Kommentare - Kommentar verfassen
Schanigarten!
 Zum ersten Mal heuer sitzen wir beim Schwabl im Schanigarten. Sweet! (Sowas muß man ausnutzen, bevors wieder so heiß wird, daß man nicht mehr ins Freie gehen mag.)
Zum ersten Mal heuer sitzen wir beim Schwabl im Schanigarten. Sweet! (Sowas muß man ausnutzen, bevors wieder so heiß wird, daß man nicht mehr ins Freie gehen mag.)
Besonders putzig: Wir können den Dienstwagen vom Chef bewundern. Da hab sogar ich Auto-Analphabet auf die Marke gschaut und im Internet nachgeschlagen: Ein Renault Twizy ist es, komplett mit schwabl-wirt.at-Aufdruck. Sexy. :)
Ort anzeigen auf: Google Maps,
Mapquest
Suche nach Websites und
Fotos in der Nähe
11 Kommentare - Kommentar verfassen
Vivaldi-Tablet mit innovativem Hardwaredesign
 Ich gebs ja ganz ehrlich zu: Nachdem ich schon wieder zwei Monate nichts gehört hatte vom Vivaldi-Tablet (der letzte Eintrag dazu ist vom Februar), hab ich mir ein kleines bißchen Sorgen gemacht. Wirds noch was?
Ich gebs ja ganz ehrlich zu: Nachdem ich schon wieder zwei Monate nichts gehört hatte vom Vivaldi-Tablet (der letzte Eintrag dazu ist vom Februar), hab ich mir ein kleines bißchen Sorgen gemacht. Wirds noch was?
Es wird. Es wird innovativer, als es nach den ersten - gescheiterten - Plänen geworden wäre. Vivaldi wird ein modulares Huckepack-Tablet. Die Kernkomponenten eines PCs (CPU, Speicher, USB, Grafikchip, …) sitzen in einem eigenen Modul, das der offenen EOMA-68-Spezifikation folgt. Dieses Modul wird auf ein zweites Board gesteckt, das die Tablet-spezifischen Teile enthält: WLAN-Chip, Touchscreen-Steuerung, SIM-Karte, Kamera usw. finden dort ihren Platz. Beide Teile werden vom Vivaldi-Team gemeinsam mit Rhombus-Tech entworfen.
Was ist der Vorteil dieser Konstruktion? Erstens kann die ins Kernmodul investierte Arbeit (Hardware-Layout plus Treiber) in allen möglichen Gerätetypen wiederverwendet werden. Ein Mediaplayer zum Beispiel braucht weder SIM-Karte noch Kamera, dafür aber viel Massenspeicher. Das fertige Kernmodul läßt sich unverändert auf eine neue Platine setzen, die nur mehr die Steuerung der Festplatten übernimmt.
Zweitens ist das Modul so ausgelegt, daß es sich auch von einem technisch unerfahrenen Enduser stecken läßt. Es handelt sich von der Bauweise her nämlich um die gute alte PCMCIA-Karte, die alte Menschen noch von ihren Laptops kennen und die heute in elektronisch abgewandelter Form als CI-Modul in Sat-TV-Boxen und TV-Geräten steckt. Im Idealfall bedeutet das: neues Modul mit schnellerem Prozessor und mehr Speicher kaufen, Tablet aufschrauben, Module umstecken, Tablet zuschrauben, fertig ist das Upgrade. In der Apple- und Android-Welt muß man dafür ein komplett neues Gerät kaufen. (Obs tatsächlich ganz so einfach wird oder ob dieser Schritt gefinkelten Bastlern vorbehalten bleibt, wird vom Design des Gehäuses abhängen.)
Drittens ist es damit sehr leicht möglich, trotz der wahrscheinlich kleinen Stückzahl auch ausgefallenere Sonderwünsche zu erfüllen. Die vom Vivaldi-Team momentan ins Auge gefaßte Hardware enthält zum Beispiel einen Chip, für den die freien Treiber noch nicht fertiggestellt sind. Einer wahrscheinlich kleine Kundengruppe wäre es wichtig, auf die Performancevorteile dieses Chips zu verzichten, wenn dafür wirklich ausschließlich freie Software zum Einsatz kommen kann. Kein Problem: Das Tablet bleibt, wie es ist. Nur das Kernmodul wird gegen eine „Variante B“ mit dem alternativen Chip ausgetauscht.
Aaron Seigo spricht in diesem Video 20 Minuten lang sehr detailliert über jeden Aspekt des Platinendesigns. Mich hats interessiert, vielleicht geht das nicht jedem so. ;) Was jedenfalls als „Moral von der Geschicht“ gelten kann: Hätte Vivaldi nicht mit dem ursprünglichen Hardware-Partner Schiffbruch erlitten, wäre das Projekt nicht insgesamt aufgrund der Nichtverfügbarkeit ausreichend freier Hardware ganz knapp vor dem Scheitern gestanden, Aaron und sein Team hätten nie zu dieser innovativen Lösung gefunden. Eine durchaus realistische Hoffnung ist nämlich, daß weitere interessante Hardware-Projekte entstehen, sobald das Kernmodul verfügbar und bestellbar ist.
4 Kommentare - Kommentar verfassen
Naschmarkt :(
Heut bin ich irgendwo falsch abgebogen und war mitten drin im Naschmarkt-Gewusel. Nun muß man fairerweise sagen: Dort, wo's Lebensmittel zu kaufen gibt, ist die Sache ja noch fast erträglich. Da fotografieren halt Japanerinnen jede Erdbeere einzeln ab, während daneben eßgestörte Lehrerinnen von einem verzweifelten türkischen Verkäufer Details aus der Jugend eines bestimmten Gewürzsträußchens erfragen. Soll sein, so ein Verkäufer läßt sich zur Not auch trösten.
Was absolut gar nicht geht ist die Gastro-Szene, die sich dort etabliert hat. Dort wird alles angespült, was Wien an gesellschaftlichem Abschaum zu bieten hat: echte Hipsters (die ich in der Form erstmals in freier Wildbahn gesehen hab; bisher kannte ich die nur als Karikaturen im Web), schick zurechtgestylte Marketingtussen, Zahnarztgattinnen in frischem Schönbrunnergelb, Wannabe-Modeltypen mit Sonnenbrillen und festgeklebten Haarsträhnen, … ein wahres Horrorkabinett. Hedonismus und Selbstdarstellung, Egomanie und Eitelkeit ohne Grenzen. Man ist versucht, aus Asien importiertes Geflügel dort anzufüttern.
Note to self: Nur in einer Gruppe wieder hingehen, zusammen mit Menschen, mit denen man bösartigst über diese Eiterbeulen der Gesellschaft ablästern kann. ;)
Ort anzeigen auf: Google Maps,
Mapquest
Suche nach Websites und
Fotos in der Nähe
21 Kommentare - Kommentar verfassen
Nutella-Diebstahl: Wir sind aufgeflogen
 Tja. Auch unser perfektestes Verbrechen fliegt auf, wenn uns ein gewiefter Profiler zu gut kennt und eins und eins zusammenzählt.
Tja. Auch unser perfektestes Verbrechen fliegt auf, wenn uns ein gewiefter Profiler zu gut kennt und eins und eins zusammenzählt.
Gestern landete eine E-Mail in meinem Postkasterl. Sie enthielt einen Link auf einen Bericht über den doch eher ungewöhnlichen Nutella-Diebstahl in Hessen:
Rund 5000 Kilogramm Nutella haben Diebe im osthessischen Niederaula vom Anhänger eines Lastwagens gestohlen. […] Die Unbekannten hatten das Schloss des abgestellten Containers aufgebrochen und Tausende Gläser der süßen Schokocreme von dem Auflieger geräumt, wie die Polizei in Bad Hersfeld mitteilte. Wert der Beute: Rund 15 000 Euro.
Gleich drunter in der Mail dann:
Warum sagt ihr denn nicht, dass ihr in Deutschland wart??? :)
Tja, was soll ich sagen? Aufgeflogen! Die Mail kam natürlich aus Trassenheide, vom detektivischsten Koch der Insel. Der kennt unsere Sucht nach dem klebrigen Zeug (siehe unter anderem dieser Kurzeintrag) und hat messerscharf kombiniert: So einen frechen Coup können nur die coolen Gangsta aus dem Alpenland abgezogen haben. ;)
Ich sag mal: Wenn uns keiner an die Bullen verpfeift, geben wir vielleicht einen Teil der Beute ab. :)
4 Kommentare - Kommentar verfassen
Mhmhmhm … Mohnknödel
 Es gibt so ein paar Sachen, die der Schwabl viel zu selten auf der Tageskarte hat. Die Mohnknödel gehören dazu. Fluffiger Topfenteig, saftige Mohnfüllung, lockerer Staubzucker drüber … egal was (und wieviel) man vorher gegessen hat, das muß sein. Da stören auch die 15min Wartezeit nicht.
Es gibt so ein paar Sachen, die der Schwabl viel zu selten auf der Tageskarte hat. Die Mohnknödel gehören dazu. Fluffiger Topfenteig, saftige Mohnfüllung, lockerer Staubzucker drüber … egal was (und wieviel) man vorher gegessen hat, das muß sein. Da stören auch die 15min Wartezeit nicht.Ort anzeigen auf: Google Maps,
Mapquest
Suche nach Websites und
Fotos in der Nähe
5 Kommentare - Kommentar verfassen
Gentoo: package.keywords aufräumen
ein und hat sie schon zur Verfügung. Wenn sie Probleme machen, löscht man sie raus. Ganz einfach.
Zu einfach für Faulpelze wie mich: Was ich mal in die package.keywords geschrieben hab, das wird kaum jemals wieder gelöscht. So ist die Datei bei mir mittlerweile auf über 600 Einträge angewachsen, und das wird hin und wieder zum Problem. Da sind Pakete doppelt drin, einfach in verschiedenen Versionen. Andere Pakete sind schon lang nicht mehr installiert, trotzdem aber noch in der package.keywords. Vor allem aber kommt es natürlich laufend vor, daß die von mir vor Jahren als instabil eingetragenen Testversionen längst im stabilen Zweig von Gentoo gelandet sind und der Eintrag in package.keywords überflüssig ist.
Was macht man, um ein bißchen aufzuräumen? Die Einträge Zeile für Zeile zu überprüfen ist keine gute Idee. Da sucht man sich zum Affen. Gottseidank gibt es das Programm eix bzw. das im gleichen Palet enthaltene Script eix-test-obsolete.
Zuerst führt man den Befehl eix-update aus. Er generiert bzw. aktualisiert eine Datenbank aus dem Portage-Tree. Danach gibt man eix-test-obsolete ein: Damit wird die soeben erzeugte Datenbank mit den am System installierten Paketen verglichen, auch die Dateien in /etc/portage werden mit einbezogen. Was dabei herauskommt sind gegebenenfalls Hinweise auf Pakete, die noch installiert sind, obwohl Gentoo sind nicht mehr unterstützt. Vor allem aber spuckt eix-test-obsolete alle verdächtigen Kandidaten aus package.keywords (und verwandten Dateien wie package.use) aus. Die kann man sich dann gezielt ansehen, eventuell ganz aus der Liste löschen oder gegen eine aktuellere Version austauschen.
Ich machs natürlich nicht regelmäßig, obwohl ichs mir vorgenommen hab. Allerdings muß eix-test-obsolete immer dann aushelfen, wenn beim update eigentümliche Blocks auftreten, die ich mir nicht erklären kann. Die betroffenen Pakete findet man sehr häufig auch in der von eix-test-obsolete generierten Liste … Und dann kommt der Frühjahrsputz. :)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Handy-Signatur: Praxiserfahrung
Wie funktionierts nun in der Praxis?
The Good
Ich wollte die Petition online unterschreiben. Ich konnte die Petition online unterschreiben. Die praktische Anwendung ist simpel: Telefonnummer und Passwort eingeben, auf TAN warten (kommt per SMS), TAN eingeben, fertig.
Der Anmeldevorgang zur Handy-Signatur führt zwar über insgesamt drei völlig unterschiedlich gehaltene Websites, was ernsthafte Zweifel an der Seriosität des Angebots aufkommen läßt. (a-trust verweist auf Handy-Signatur.at, von dort gehts weiter zu Sendstation.at.) Ist man dann aber erst mal bei Sendstation angekommen, verläuft der erste Teil der Registrierung schmerzlos. (Wer die Voraussetzungen für diese Anmeldung per Online-Banking nicht erfüllt, findet auf Handy-Signatur.at genügend Alternativen.) Leider ist das aber nur der erste Teil …
Ach ja, auch noch „good“: Die Handy-Signatur ist gratis.
The Bad
Auch bei der von mir gewählten Online-Anmeldung ist die Handy-Signatur nicht sofort startklar. Als letzter Schritt im Prozess wird nämlich eine PIN per Briefpost an die Meldeadresse geschickt. Wahrscheinlich soll damit sichergestellt werden, daß die Adresse wirklich stimmt. Das ist einerseits frustrierend (wer online registriert, will online bedient werden), funktioniert außerdem aber auch nicht. Ich habe am 25.3. den online-Teil der Registrierung abgeschlossen. Der Brief sollte „innerhalb von 2-3 Werktagen“ bei mir ankommen. Heute, am 3.4., hatte ich ihn im Postkasten: das sind sechs Werktage, mehr als eine Woche. Ausgedruckt wurde er am 28.3., Poststempel trägt er sicherheitshalber gleich keinen. Man sollte also, wenn man die Handy-Signatur beantragt, besser nichts Dringendes damit erledigen wollen.
Bei der Gelegenheit konnte ich übrigens auch gleich den Telefonsupport kennenlernen. Ich hab dort nämlich angerufen, weil ich wissen wollte, ob irgendetwas nachvollziehbar „hängt“ im System. Die Hotline „weiß grundsätzlich nichts“ (das war der erste Satz nach der Schilderung meines Problems), verläßt sich auf hilfreiche Anregungen durch den Neukunden („Könnten Sie vielleicht dies oder jenes nachsehen?“ - „Ah ja, das geht schon.“) und gibt im Brustton der Überzeugung zwei völlig widersprüchliche Informationen zum Status meiner Anmeldung. Daß es sich dabei um eine kostenpflichtige 0900er-Nummer handelt, macht die Sache nicht besser, ist aber eine lustige Zusatzinfo, wenns um meinen Lieblingssatz in diesem Gespräch geht: „Könnten Sie bitte langsamer sprechen?“
The Ugly
Nachdem ich die Petition erfolgreich unterzeichnet hatte, wollte ich noch weitere Standardanwendungen ausprobieren: Den kostenlosen „e-Tresor“ (2GB Cloud-Speicher), das Signieren von PDFs sowie das Überprüfen einer Signatur. Das Login in den e-Tresor schlug fehl, die Anwendung zur Signaturüberprüfung erklärte mir, daß das soeben erst am gleichen Server von mir selbst signierte PDF eine ungültige Signatur mit 0 Bytes aufwies. Das schafft kein Vertrauen in die Infrastruktur. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese mobile Bürgerkarte jetzt verwenden will, um mir meine Behördenschreiben (RSa und RSb) elektronisch zustellen zu lassen. Von einer eGovernment-Lösung hätte ich grundsätzlich erwartet, daß sie funktioniert.
15 Kommentare - Kommentar verfassen
Sommerzeit!
Open Data: Wiener Linien „haben verstanden“
 Die Wiener Linien geben sich geschlagen: Sie
Die Wiener Linien geben sich geschlagen: Sie haben verstandenund wollen ab Sommer ihre Fahrplan- und Echtzeitdaten als Open Data zur Verfügung stellen. (Siehe ihr Blog-Eintrag.)
Und es muß jetzt einfach raus, bevor mir jetzt irgendwas platzt: Ich! Mein Thema! Mein Baby! Und damit auch mein Erfolg, irgendwie. :)
Natürlich ist es in Wahrheit Robert Harm, der mit seiner unglaublich erfolgreichen Initiative jetzt den Umschwung bewirkt hat. Natürlich war es Marco Schreuder, der 2010 das Thema politisch aufbereitet und im Gemeinderat eingebracht hat. Natürlich waren es eine ganze Menge von Journalisten, die über drei Jahre hinweg an dem Thema drangeblieben sind und nicht locker gelassen haben. Aber: Begonnen hats hier, hier auf diesem Blog. :)
Das da ist der erste Artikel überhaupt zum Thema. (Nicht mein erster Artikel. Der erste Artikel.) Dazu gibts einen Kommentar vom Erik, in dem er verspricht, das Thema bei den Grünen zu deponieren, wo er damals schon aktiv war.
Daß es bei den Grünen angekommen ist, zeigt schließlich dieser Artikel von Marco Schreuder, in dem er sich ausdrücklich auf meine Informationen und meinen Blog-Eintrag beruft. Unmittelbar darauf hat er den entsprechenden Antrag im Gemeinderat eingebracht.
Seither kam das Thema nie mehr wieder zu Ruhe. Journalisten, Politiker, dazwischen wieder Sticheleien von mir, am erfolgreichsten jetzt Robert Harm von Open3 … und irgendwann bricht der Damm. Das ist heute passiert. Die Wiener Linien versprechen, ihre Daten frei zugänglich zu machen.
Ich bin ein kleines bißchen stolz auf das Korn, das ich damals in fruchtbaren Boden gesteckt hab - auch wenn andere die Pflanze gegossen und mit grünem Daumen umsorgt haben. Hoffentlich kommt jetzt im Sommer wirklich das raus, was wir uns alle wünschen und was vor allem die Entwickler brauchen. (Es wäre ja sinnlos, nur die Fahrplandaten bereitzustellen, die Echtzeitinfos aber erst recht zurückzuhalten.) Eine Auswahl von Programmen, die im Prinzip fertig sind und nur mehr auf die Datenquelle warten, ist hier zu sehen.
9 Kommentare - Kommentar verfassen
Open Data: Petition gegen Wiener Linien
Zum ersten Mal seit 2010 gibt es nun wieder eine konkrete politische Initiative, die diesen Mauscheleien ein Ende setzen könnte - und ich werde sie unterstützen! Eine Petition auf wien.gv.at von Robert Harm fordert:
Die Stadt Wien möge […] beschließen, dass die Datenbestände der Wiener Linien wie z.B. Echtzeitinformationen, Haltestelleninfos oder Linienpläne auch nach Open Data-Prinzipien (d.h. va. maschinenlesbar, Verwendung einer offenen Lizenz wie zB CC-BY) den Bürgern zur Verfügung gestellt werden.
Ich hab mich extra für die Bürgerkarte in Form der Handy-Signatur angemeldet, um die Petition online unterzeichnen zu können (Erfahrungen dazu in einem extra Artikel). Angeblich soll es aber ab nächster Woche auch irgendwie möglich sein Seit heute ist es auch möglich, „offline“ zu unterschreiben.
Anlaß für die aktuelle Petition ist die übliche Vorgehensweise der Wiener Linien: Ein noch in Entwicklung befindliches, aber bereits auf Google Play erhältliches Programm zur Abfrage der öffentlichen Daten wurde von den Anwälten der Wiener Linien mit Klagsdrohungen aus dem Verkehr gezogen. Genau so hat es 2010 begonnen, wie ich zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert wurde. Ein kurzer Rückblick, der auch erklärt, warum mich die Sache so sehr ärgert und bewegt:
Anfang 2010 habe ich für mein damaliges Handy, das Nokia N900, das Programm OpenQando verwendet. Da die Wiener Linien ein Nischenprodukt wie das N900 nicht unterstützten, war OpenQando für mich die einzige Möglichkeit, bequem an Echtzeitinformationen über die von mir benutzten Straßenbahnlinien zu bekommen. Es war ein extrem gut gemachtes Stück Software.
Im Mai 2010 hat mich der Programmierer von OpenQando angeschrieben: Ich möchte doch bitte den begeisterten Artikel über das Programm aus meinem Blog entfernen. Die Wiener Linien hätten ihm rechtliche Konsequenzen angedroht, wenn er die Entwicklung nicht einstellt und alle Hinweise auf die Software aus dem Internet löscht. Den Artikel dazu gibts noch hier.
Einige Monate später, im September 2010, wurde der damalige Landtagsabgeordnete Marco Schreuder auf die Situation aufmerksam und verfaßte ebenfalls einen Artikel dazu. Wichtiger noch: Er brachte gemeinsam mit seiner grünen Fraktionskollegin Puller einen Antrag ein, der die Situation im Sinne von „Open Data“ klären sollte. ÖVP und FPÖ stimmten den Grünen zu, nur die damalige SPÖ-Mehrheit schmetterte den Antrag ab.
Wien-Wahl, rot-grüne Koalition, Regierungsübereinkommen. Im Novenber 2010 bekannte sich die grundsätzlich mauernde SPÖ im Regierungsübereinkommen mit den Grünen unter der Kapitelüberschrift „Open Data, Open Government“ zumindest dazu, die Möglichkeiten und etwaige Risiken von „Open Data“ und „Open Government“ - also der freie Zugang zu bestimmten öffentlichen (nicht personenbezogenen) Daten in für Menschen und Maschinen lesbarer Form - für Wien zu erörtern
. Das war kein großer Schritt vorwärts, aber wenigstens war die Tür einen Spalt offen. Ich habe berichtet.
Juli 2012: In einem Online-Chat fragte eine Journalistin von derstandard.at den Aufsichtsratsvorsitzenden der Wiener Linien, Eduard Winter, nach dem Stand der Dinge. Winter leistete sich eine ungeheuerliche Entgleisung: Die Wiener Linien hätten, so sagt er, bzgl. Open Data die Befürchtung, daß hier möglicherweise kriminelle Energie frei werden könnte - zum Schaden unserer Fahrgäste.
Informationen über die aktuellen Busverspätungen als sicherheitskritische Geheiminformation, die vor Terroristen geschützt werden muß? Unfaßbar.
März 2013: Fast genau drei Jahre nach dem N900-Skandal wiederholen nun die Wiener Linien die gleiche juristische Einschüchterungstaktik mit einem anderen Programmierer, einem anderen Programm. Diesmal ist es Robert Harm, Vorstand des Open-Data-Vereins Open3, der darauf regiert und eine Online-Petition auf Basis des Gesetzes über Petitionen in Wien einbringt.
Wenn ich das Gesetz richtig verstanden habe, ist bei Erreichen der Hürde von 500 Unterschriften eine Behandlung im Petitionsausschuß vorgesehen, mehr nicht. Der Ausschuß kann sich noch formale Gründe ausdenken, die gegen die Weiterbehandlung der Eingabe sprechen. Im besten Fall spricht er eine Empfehlung über die weitere Vorgangsweise
aus und die Petition ist durch den für Petitionen zuständigen amtsführenden Stadtrat schriftlich gegenüber der Einbringerin bzw. dem Einbringer zu beantworten
. Mit anderen Worten: Es besteht keinerlei Verpflichtung, die Eingabe in irgendeiner Weise ernsthaft und inhaltlich zu diskutieren. Trotzdem zahlt es sich auf jeden Fall aus, das Instrument zu nutzen: Es muß den Verantwortlichen klar werden, daß sie der Öffnung der durch Steuermittel finanzierten Daten der Wiener Linien nicht durch bloßes Aussitzen entkommen können. Wie auch immer der Vertrag zwischen den Wiener Linien und Fluidtime (die Firma hinter dem einzigen autorisierten Programm „Qando“) aussieht: Die Details müssen an die Öffentlichkeit. Zahlen die Wiener am Ende der Fluidtime etwas dafür, daß sie über ihren eigenen Datenbestand nicht frei verfügen dürfen? Wie viel hat die Entwicklung von Qando bisher gekostet? Hätte man sich das nicht alles sparen können, indem man einfach nur die Daten freigegeben hätte?
2 Kommentare - Kommentar verfassen
ESC 2013: Meine (neuen) Favoriten
 Gestern hab ichs versprochen, heut lös ichs ein: Hier sind meine derzeitigen Favoriten für den Song Contest 2013. (Die erste Zusammenstellung von vor zwei Wochen gibts hier.)
Gestern hab ichs versprochen, heut lös ichs ein: Hier sind meine derzeitigen Favoriten für den Song Contest 2013. (Die erste Zusammenstellung von vor zwei Wochen gibts hier.)| Rang | Land | Song | ⇅ |
| Interpret | |||
| 1 | Ungarn | Kedvesem | ↔ |
| ByeAlex | |||
| 2 | Griechenland | Alcohol Is Free | ↗ |
| Koza Mostra & Agathonas Iakovidis | |||
| 3 | Island | Ég á Líf | ↗ |
| Eyþór Ingi Gunnlaugsson | |||
| 4 | Finnland | Marry Me | ↘ |
| Krista Siegfrids | |||
| 5 | Dänemark | Only Teardrops | ↘ |
| Emmelie de Forest | |||
| 6 | Kroatien | Mižerja | ↘ |
| Klapa s Mora | |||
| 7 | Frankreich | L'Enfer Et Moi | ↑ |
| Amandine Bourgeois | |||
| 8 | Schweden | You | ↑ |
| Robin Stjernberg | |||
| 9 | Aserbaidschan | Hold Me | ↑ |
| Farid Mammadov | |||
| 10 | Malta | Tomorrow | ↔ |
| Gianluca Bezzina |
Da ist eine Tendenz erkennbar: Ungarn, Griechenland und Island (wunderschönes Video heuer!) bilden meine drei Favoriten. Die Reihung unter diesen ersten Songs ist auch gar nicht so in Stein gemeißelt und hängt von Tag und Stimmung ab. Finnland auf Platz vier ist noch ziemlich sicher im Moment und setzt sich von den Konkurrenten ab. Spätestens ab Platz fünf aber kommen dann die "eh OK"-Songs. Zumindest darunter gibts ein paar Neueinsteiger.
Aus meiner persönlichen Bestenliste raus sind mittlerweile Bonnie Tyler (Vereinigtes Königreich, besser bekannt als le Royaume-Uni), die Gruppe Takasa (angeblich Suaheli für „reinigen“, wahrscheinlich eher „The Artists Known As Salvation Army“) für die Schweiz und PeR für Lettland.
Wie viele Chancen haben sie, meine Lieblinge? Die Buchmacher sehen keinen meiner Top 3 besonders erfolgreich. Ungarn: Platz 34; Griechenland: Platz 17; Island: Platz 36. Noch schlimmer: Alle drei treten im gleichen Semifinale gegeneinander an. Am allerschlimmsten: Es ist nicht „unser“ Semifinale, ich kann also für die drei Songs nicht amrufen. Schlechte Karten.
Gerade mal zwei Länder sind es noch, die sowohl die Buchmacher als auch ich unter die ersten 10 reihen: Schweden und Dänemark. Mal sehen, ob diese Schnittmenge Glück bringt. ;)
6 Kommentare - Kommentar verfassen




